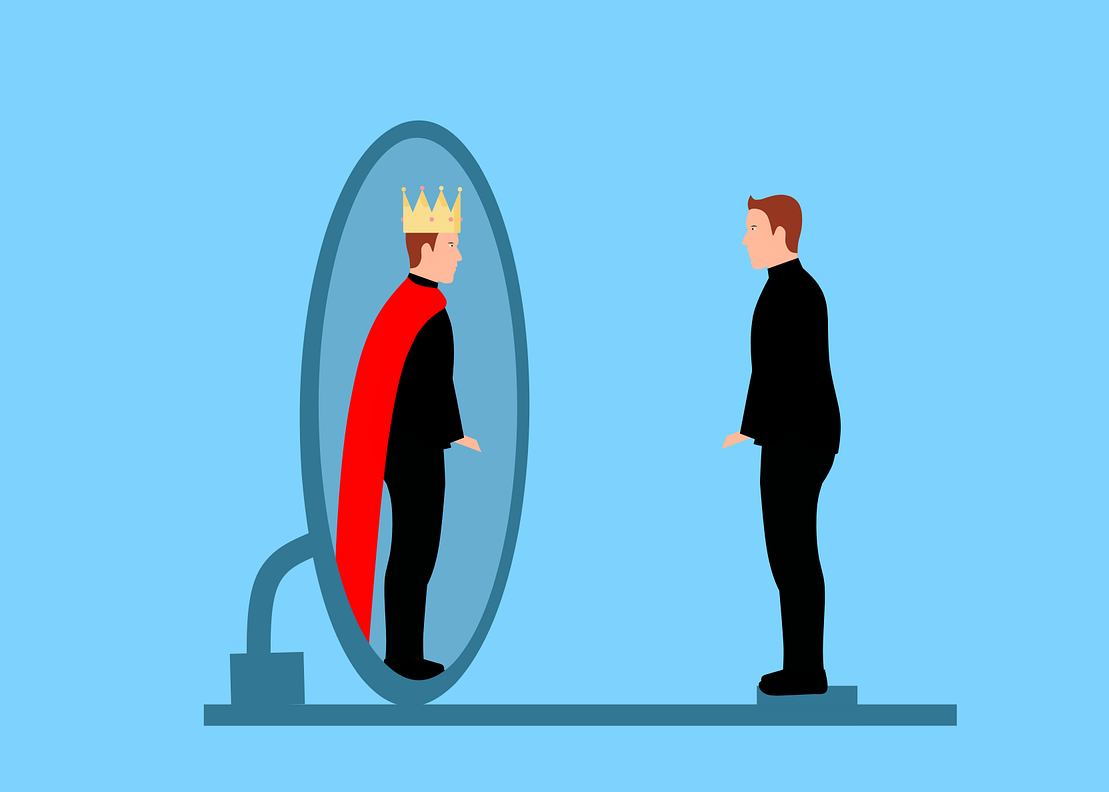Sei gut zu dir selbst –In einer Gesellschaft, in der der Wettbewerb so intensiv ist, wie viele Menschen sind wirklich zufrieden mit sich selbst? Ein positives Selbstwertgefühl, insbesondere das Gefühl, überdurchschnittlich zu sein, ist meist nur von kurzer Dauer. Selbst die kleinsten Fehler scheinen bereits ein Versagen zu bedeuten. Um uns selbst positiv wahrzunehmen, neigen wir dazu, uns zu loben und andere abzuwerten, um uns im Vergleich besser zu fühlen.
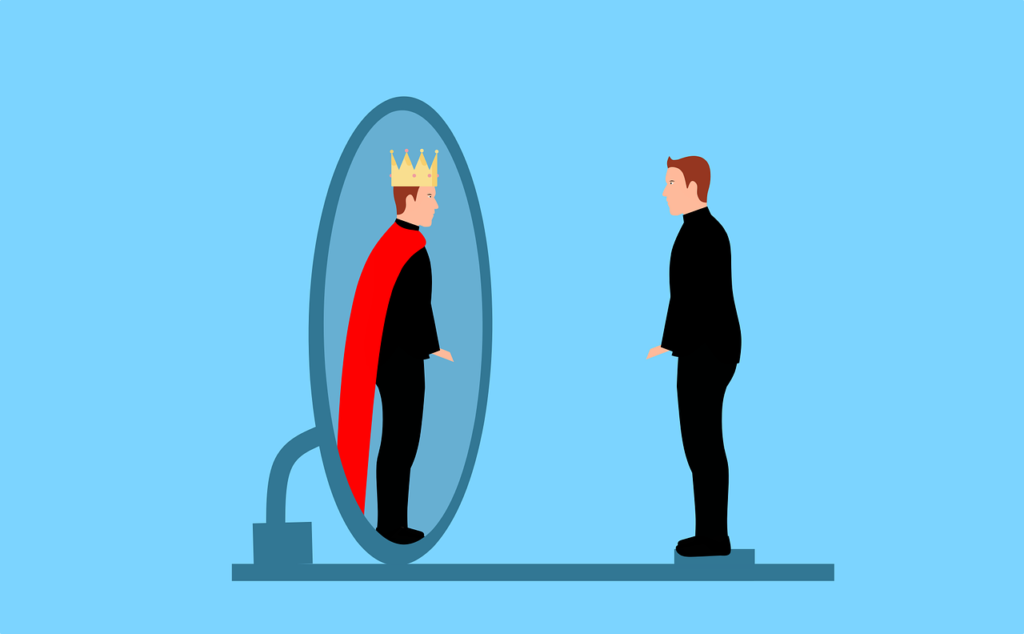
Gleichzeitig, wenn wir schließlich unsere eigenen Schwächen und Fehler anerkennen, neigen die meisten Menschen dazu, hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. „Ich bin nicht gut genug, ich bin ein Versager.“ Im Wettlauf des Lebens, wenn wir nicht die Oberhand gewinnen, bestrafen wir uns selbst unerbittlich. Es ist wahrscheinlich, dass wir noch nie jemanden so schlecht behandelt haben wie uns selbst.
Doch was ist die Lösung?
Die Antwort lautet: Selbstmitgefühl.
Einleitung: Selbstmitgefühl und seine drei Grundelemente
„Mitgefühl“ bedeutet, Leiden wahrzunehmen und zu verstehen, sowie eine wohlwollende Haltung gegenüber jemandem einzunehmen, der sich in einer schwierigen Situation befindet. Mitgefühl erkennt die gemeinsame menschliche Erfahrung an – sie ist unvollkommen und verletzlich.
Selbstmitgefühl bedeutet, dass wir aufhören, uns ständig selbst zu bewerten und zu beurteilen, und stattdessen mit Offenheit und Akzeptanz auf uns selbst schauen. Es bedeutet, uns selbst nicht als „gut“ oder „schlecht“ zu etikettieren, sondern uns freundlich, fürsorglich und verständnisvoll zu behandeln – so wie wir es bei einem Freund oder sogar bei einem Fremden tun würden.
Selbstmitgefühl umfasst drei zentrale Bestandteile:
- Sei gut zu dir selbst – Das bedeutet, dass wir uns liebevoll und verständnisvoll behandeln, anstatt uns selbst zu kritisieren und zu verurteilen.
- Erkenne die gemeinsame Menschlichkeit – Das Gefühl, durch gemeinsame Lebenserfahrungen mit anderen verbunden zu sein, anstatt uns durch unser Leid isoliert und getrennt zu fühlen.
- Sei achtsam im Moment – Eine ausgewogene Wahrnehmung unserer Erfahrungen, bei der wir unser Leid weder ignorieren noch übertreiben.
Um echtes Selbstmitgefühl zu entwickeln, müssen diese drei Elemente vorhanden sein und miteinander verschmelzen. Wir werden diese Elemente in drei Blogartikeln vorstellen. Heute geht es um das erste Element: Sei gut zu dir selbst.
Im Folgenden werden Sie lesen:
1. Was bedeutet es, gut zu sich selbst zu sein?
Gut zu sich selbst zu sein bedeutet, dass wir aufhören, uns ständig selbst zu bewerten und zu verurteilen. Es erfordert, dass wir unsere Schwächen und Misserfolge annehmen und erkennen, wie sehr wir uns selbst durch unsere harsche Selbstkritik schaden. Gleichzeitig bedeutet es, aktiv Mitgefühl für uns selbst zu zeigen, so wie wir es für einen Freund tun würden, der sich in einer schwierigen Lage befindet. Es geht darum, uns selbst nicht als ein Problem zu betrachten, das gelöst werden muss, sondern als einen wertvollen, fürsorgenswerten Menschen. Es bedeutet, uns selbst mit Wärme und Freundlichkeit zu begegnen.
2. Warum ist es notwendig, gut zu sich selbst zu sein?
Unsere westliche Kultur betont, wie wichtig es ist, freundlich zu Freunden, Familie und Nachbarn zu sein, aber das Wohlwollen gegenüber uns selbst wird oft vernachlässigt. Wenn wir Fehler machen oder scheitern, begegnen wir uns oft mit einem inneren Schlag, anstatt uns selbst eine stützende Hand zu reichen. Viele empfinden sogar den Gedanken, sich selbst zu trösten, als absurd. Die Idee, freundlich zu sich selbst zu sein, wird häufig als unangebracht angesehen – und solche Gedanken wurzeln oft schon in der Kindheit.
Doch diese Haltung beraubt uns einer kraftvollen Strategie, um den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Jeder macht Fehler, und sich zu blamieren oder zu scheitern, ist ein unvermeidlicher Teil des Lebens. Selbst wenn wir auf die Nase fallen, haben wir immer noch andere Optionen.
3. Wie können wir gut zu uns selbst sein?
Erstens: Übe das Umarmen

Wenn wir uns angespannt, traurig oder selbstkritisch fühlen, können wir uns selbst sanft umarmen: Streichele deine Arme, berühre dein Gesicht sanft oder schaukle leicht deinen Körper. Wenn du dich in Gesellschaft anderer befindest und dich nicht umarmen kannst, kannst du deine Arme verschränken und sanft deine Hände halten. Selbst wenn eine körperliche Umarmung nicht möglich ist, kannst du dir eine solche Umarmung in deiner Vorstellung vorstellen. Übe diese Geste mehrmals täglich über mindestens eine Woche, um dir selbst Trost auf körperlicher Ebene zur Gewohnheit zu machen.
Zweitens: Berühre dich selbst sanft

Wenn wir uns in einer schwierigen Lage befinden, können wir uns selbst freundlich auf die Arme streicheln und in einem mitfühlenden Ton zu uns sprechen. Es ist wichtig, unsere inneren Gespräche neu zu gestalten, indem wir kritische Selbstgespräche durch mitfühlende ersetzen. Hierzu können wir uns folgende Fragen stellen:
- Was nehme ich wahr?
- Was fühle ich?
- Was brauche ich gerade?
- Habe ich eine Bitte an mich selbst oder an jemand anderen?
Diese Fragen helfen uns, auf unsere dringendsten und authentischsten Bedürfnisse zu hören.
Drittens: Verändere die kritischen Selbstgespräche

Wir können uns durch das Führen eines Tagebuchs mit uns selbst unterhalten. Wenn das nicht möglich ist, können wir laut zu uns selbst sprechen oder still über unsere Gedanken reflektieren. Um kritische Selbstgespräche zu verändern, sind folgende Schritte hilfreich:
- Erkenne die Momente der Selbstkritik: Viele von uns kritisieren sich unbewusst ständig. Sobald wir uns schlecht fühlen, sollten wir innehalten und uns fragen, was wir gerade zu uns selbst gesagt haben. Welche Worte haben wir verwendet? Wie oft wiederholen sie sich? Welche Tonalität hatten sie – scharf, kalt oder wütend? Erinnern diese Stimmen an Menschen, die uns früher kritisiert haben?
- Mache die Selbstkritik mitfühlender: Anstatt deinen inneren Kritiker zu beschimpfen, sage: „Ich weiß, du willst mich beschützen und mir zeigen, wie ich mich verbessern kann, aber deine harsche Kritik hilft mir nicht weiter. Bitte hör auf, mich so hart zu beurteilen, es fügt mir nur unnötiges Leid zu.“
- Formuliere die Worte des Kritikers um: Denke darüber nach, was ein guter Freund in dieser Situation zu dir sagen würde. Zum Beispiel: „Ich weiß, dass du diese Kekse gegessen hast, weil du traurig bist. Du dachtest, es würde dir helfen, aber es hat die Situation nur verschlimmert. Dein Körper fühlt sich jetzt nicht gut. Warum gehst du nicht ein bisschen spazieren, um dich besser zu fühlen?“ Während du solche Gespräche führst, kannst du sanft deine Arme klopfen oder deine Hände auf dein Gesicht legen. Selbst wenn du zunächst keine Wärme für dich selbst empfinden kannst, können freundliche körperliche Gesten dein Mitgefühlssystem aktivieren und Oxytocin freisetzen.
Wenn wir lernen, gut zu uns selbst zu sein, können wir in Momenten des Schmerzes die Wärme und Liebe aus unserem Inneren erfahren. Egal wie schwer die Zeiten sind, wir können uns selbst Trost spenden. So wie ein Kind in den Armen seiner Mutter Geborgenheit findet, können wir unser eigenes Leid lindern.
Wir müssen nicht darauf warten, dass das Leben perfekt wird, oder andere zwingen, uns die gewünschte Liebe zu geben. Wir müssen die ersehnte Akzeptanz und Sicherheit nicht im Außen suchen. Das bedeutet nicht, dass wir andere nicht brauchen. Aber wer kennt unsere Gefühle besser als wir selbst? Wer versteht unser Leiden und unsere Ängste besser? Wer ist unser zuverlässigster Begleiter? Es ist niemand anderes als wir selbst.
Wussten Sie, dass das Überwinden der Opfermentalität uns sogar dabei helfen kann, finanzielle Freiheit zu erreichen? Wie das funktioniert? Sie können mehr dazu in unserem Artikel 3 Merkmale des Opferdenkens – Hindernisse zur finanziellen Freiheit erfahren.
Quelle: Kristin Neff: Selbstmitgefühl: Wie wir uns mit unseren Schwächen versöhnen und uns selbst der beste Freund werden.