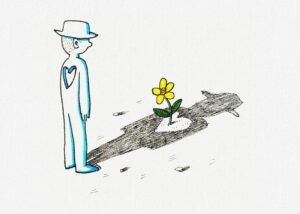Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie nach einem Rückschlag in der Arbeit immer wieder darüber nachdenken, was genau schiefgelaufen ist und warum?
Oder sind Sie oft zu perfektionistisch und haben Angst vor Fehlern, was dazu führt, dass Sie Ihre eigenen Handlungen übermäßig reflektieren?
In stressigen Situationen bemerken Sie vielleicht, dass Sie in endlosen Gedankenkreisen stecken und versuchen, eine Lösung zu finden, sich aber immer mehr verwirrt fühlen?
Solche Situationen könnten typische Anzeichen von „Rumination“ sein.
Studien zeigen, dass Rumination eng mit einer Neigung zum Perfektionismus verbunden ist. Übermäßige Sorge um Fehler und zu hohe persönliche Standards können zu einer Beeinträchtigung des eigenen Studien- oder Arbeitslebens führen.
Langfristiger Stress kann dazu führen, dass Menschen durch ständiges Nachdenken über Probleme versuchen, Lösungen zu finden, jedoch immer tiefer in die Falle der Rumination tappen.
Das Erkennen dieser Denkweisen hilft uns, unseren mentalen Zustand besser zu verstehen und wirksame Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen und uns zu verbessern.
Als Nächstes erfahren Sie,
1. Was ist Rumination?
Rumination (zu Deutsch: „Nachgrübeln“ oder „Grübeln“) wird typischerweise als das wiederholte, passive Nachdenken über ein negatives Ereignis, die damit verbundenen negativen Gefühle sowie deren Ursachen und Folgen beschrieben.
Diese Denkweise ist selbstbezogen und fokussiert sich auf vergangene negative Erlebnisse, wodurch es schwerfällt, diese Gedanken zu unterbrechen – oft entsteht ein unaufhörlicher, schädlicher Kreis.
Die Merkmale der Rumination umfassen:
-
- Negative Selbstbezug: Die Tendenz, negative Ereignisse mit eigenen Mängeln oder Fehlern zu verknüpfen, was zu einem sinkenden Selbstwertgefühl führt.
-
- Negative Affektivität: Rumination geht häufig mit anhaltenden negativen Gefühlen wie Traurigkeit, Angst oder Frustration einher.
-
- Beharrlichkeit: Diese Gedankenmuster sind hartnäckig, und es fällt schwer, sich selbst davon zu befreien.

Typische Denkmuster sind:
-
- Selbstvorwürfe: Menschen tendieren dazu, negative Ereignisse auf ihre eigenen Fehler zurückzuführen und sich immer wieder zu fragen, was sie falsch gemacht haben.
-
- Überanalyse: Eine Überinterpretation von Details eines Ereignisses, um alle möglichen Ursachen für ein negatives Ergebnis zu finden.
- Hypothetisches Nachdenken: Ständiges Grübeln über „Was wäre, wenn…?“ Szenarien, in denen man versucht, vergangene Entscheidungen zu ändern.
2. Reflektion vs. Rumination
Manchmal denken wir, dass wir unser Verhalten reflektieren, um in Zukunft besser mit ähnlichen Situationen umzugehen. Wir merken jedoch nicht, dass wir in Wirklichkeit in Rumination verfallen sind. Daher ist es wichtig, den Unterschied zwischen Reflektion und Rumination zu verstehen.
In der Psychologie gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen den beiden Konzepten:
-
- Reflektion ist ein aktiver, selbstgesteuerter Denkprozess, der darauf abzielt, aus Erfahrungen zu lernen, Lösungen zu finden und persönliches Wachstum zu fördern.
-
- Rumination ist das wiederholte, passive Nachdenken über negative Ereignisse, das oft von Selbstkritik und negativen Bewertungen begleitet wird und keine effektiven Lösungsstrategien bietet, was zu einer Verschlechterung der emotionalen Gesundheit führen kann.

Ein typisches Beispiel zur Veranschaulichung:
Szene: Hans hielt eine Präsentation in einem wichtigen Meeting, bei der es jedoch zu einigen Problemen kam, was zu einem schlechten Ergebnis führte.
-
- Reflektion: Wenn Hans „reflektiert“, wird er ruhig die gesamte Präsentation durchgehen, analysieren, welche Teile problematisch waren und warum. Er könnte denken: „War meine Zeitplanung richtig?“ „War meine Vorbereitung ausreichend?“ oder „Welche Maßnahmen kann ich beim nächsten Mal ergreifen?“ Diese Denkweise zielt darauf ab, aus der Erfahrung zu lernen und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, um in Zukunft besser abzuschneiden.
-
- Rumination: Im Gegensatz dazu könnte Hans, wenn er in Rumination verfällt, immer wieder über seine Fehler nachgrübeln, sich schuldig und enttäuscht fühlen. Er könnte ständig denken: „Warum war ich so schlecht?“ „Wird dieser Fehler meine Kollegen dazu bringen, das Vertrauen in mich zu verlieren?“ oder „Bin ich überhaupt für diesen Job geeignet?“ Diese Denkweise ist von negativen Emotionen und Selbstkritik geprägt und bietet keine konstruktiven Lösungen, was zu einem Absinken des Selbstwerts und der Stimmung führen kann.
3. Wie kann Rumination uns schaden?
Hans hat kürzlich festgestellt, dass er oft niedergeschlagen und ängstlich ist und es ihm schwerfällt, Freude zu empfinden (niedergeschlagene Stimmung). Er beginnt, den Kontakt zu seinen Freunden und seiner Familie zu meiden, lehnt soziale Aktivitäten ab und zieht sich zunehmend zurück (soziale Rückzugsverhalten). Bei der Arbeit merkt er, dass er Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, und seine Arbeitsleistung leidet oft durch Ablenkung (Aufmerksamkeitsprobleme). Hans ist nun tief in der Falle der „Rumination“ geraten. Niedergeschlagene Stimmung, sozialer Rückzug und Konzentrationsprobleme sind typische negative Auswirkungen von Rumination.
Rumination, als wiederholtes und passives Nachdenken über eigene negative Gefühle und Erlebnisse, wurde umfangreich erforscht und hat sich als schädlich für unsere psychische und physische Gesundheit herausgestellt.
Psychische Auswirkungen:
-
- Kurzfristige Auswirkungen: Rumination verstärkt unsere negativen emotionalen Erfahrungen wie Angst und Depression und verringert unsere Fähigkeit zur Emotionsregulation. Studien zeigen, dass Rumination das Abklingen negativer Selbstüberzeugungen verzögert und zu anhaltend hohem sozialen Angstniveau führen kann.
-
- Mittelfristige Auswirkungen: Anhaltende Rumination kann zu einer Ablenkung der Aufmerksamkeit, Schwierigkeiten bei Entscheidungen und einer verringerten Problemlösungsfähigkeit führen, was die tägliche Lebens- und Arbeitsleistung beeinträchtigt. Zum Beispiel wurde festgestellt, dass Rumination eine vermittelnde Rolle zwischen dem Kontakt mit gewalttätigen Umfeldern und Online-Aggressionen bei Studierenden spielt, was ihre Auswirkungen auf das Verhalten verdeutlicht.
-
- Langfristige Auswirkungen: Menschen, die langfristig in Rumination gefangen sind, entwickeln eher chronische Depressionen, generalisierte Angststörungen und andere psychische Probleme, mit einer hohen Rückfallrate. Rumination wird als Risikofaktor für psychische Erkrankungen wie Angst, Depression und Zwangsstörungen angesehen und kann die Wirksamkeit von Interventionen in diesen Bereichen beeinflussen.
Physische Auswirkungen:
-
- Kurzfristige Auswirkungen: Rumination löst Stressreaktionen aus, die zu einer Erhöhung der Herzfrequenz, Bluthochdruck und anderen physiologischen Veränderungen führen. Studien haben gezeigt, dass Rumination, als kognitiver Stil, unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, einzuschlafen und den Schlaf aufrechtzuerhalten.
-
- Mittelfristige Auswirkungen: Anhaltende Stresszustände können das Immunsystem schwächen, was uns anfälliger für Erkältungen und andere Krankheiten macht. Rumination beeinflusst indirekt die Schlafqualität durch psychischen Stress und beeinträchtigt so auch die Immunfunktion.
-
- Langfristige Auswirkungen: Langfristige physiologische Stressreaktionen erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und andere chronische Krankheiten. Obwohl die genauen Mechanismen noch weiter untersucht werden müssen, könnte anhaltende Rumination über chronische Stresspfade negative Auswirkungen auf die physische Gesundheit haben.
Angesichts der zahlreichen negativen Auswirkungen von Rumination auf die körperliche und geistige Gesundheit empfehlen Psychologen, wirksame Interventionen wie kognitive Verhaltenstherapie und Achtsamkeitstraining zu ergreifen, um die negativen Auswirkungen zu verhindern und zu lindern. Darüber hinaus ist es entscheidend, positive emotionale Regulationsstrategien zu entwickeln, um die Häufigkeit von Rumination zu reduzieren und die psychische und physische Gesundheit zu fördern.
In diesem Zusammenhang haben Fachleute aus der Psychologie den Rumination-Reflection-Questionnaire (RRQ) entwickelt. Dieser Fragebogen kann in der klinischen Psychologie als diagnostisches Instrument genutzt werden, um Menschen mit einer Neigung zur Rumination zu identifizieren. Für uns als Individuen bietet der Fragebogen eine wertvolle Gelegenheit, unser Denken bei negativen Emotionen oder Ereignissen besser zu verstehen. Mit Hilfe von Methoden wie der kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) können wir unsere Denkmuster anpassen, Rumination reduzieren und unsere Fähigkeit zur Reflexion stärken.
Menschen, die sich in Rumination befinden, haben oft auch mit Nervenschwäche zu kämpfen. Wenn Sie ebenfalls unter solchen Symptomen leiden, können Sie diesen Artikel auf ichbinwert.de lesen: Die 3 Säulen zur Heilung von Nervenschwäche.
Die deutsche Version des Fragebogens können Sie hier herunterladen: Link zum Rumination-Reflection-Questionnaire