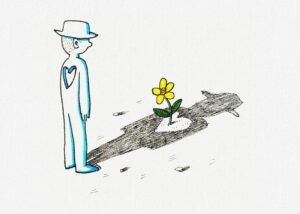Gedanken und Gefühle beeinflussen sich gegenseitig. Unsere Gedanken beeinflussen, wie wir uns fühlen – und unsere Gefühlslage hat wiederum Einfluss darauf, wie wir denken. Besonders in Momenten, in denen wir uns deprimiert oder emotional instabil fühlen, neigen wir dazu, bestimmte kognitive Verzerrungen zu entwickeln. Diese Denkverzerrungen können unser seelisches Wohlbefinden zusätzlich belasten.
Ein erster Schritt, um aus einem emotionalen Tief wieder herauszufinden, besteht darin, sich dieser verzerrten Denkweisen bewusst zu werden – sie zu erkennen, zu benennen und ihre Entstehung in bestimmten Momenten wahrzunehmen. Auf diese Weise können wir verhindern, dass sich kurzfristige Verstimmungen in eine länger anhaltende depressive Phase entwickeln.
Im Folgenden stelle ich dir sieben häufige Arten von kognitiven Verzerrungen vor:
1. Gedankenlesen (Mind Reading)
Wenn wir uns niedergeschlagen fühlen, sehnen wir uns besonders stark nach Bestätigung und Trost von anderen. Bekommen wir diese nicht, gehen wir oft automatisch davon aus, dass andere schlecht über uns denken. Dieses Muster nennt sich Gedankenlesen.

Weil wir soziale Wesen sind, versuchen wir ständig, die Gedanken und Gefühle anderer zu interpretieren. Doch in einem deprimierten Zustand verlieren wir oft die Fähigkeit, dabei realistisch zu bleiben.
„Mein Freund hat mich heute komisch angeschaut – ich wusste, dass er mich nicht leiden kann.“ Solche Schlüsse basieren nicht auf Fakten, sondern auf unserer eigenen Unsicherheit. An einem besseren Tag würden wir uns vielleicht einfach fragen, was hinter diesem Blick steckt – vielleicht sogar direkt nachfragen. Die Wahrheit ist: Nicht andere sind in solchen Momenten besonders kritisch – sondern wir selbst.
2. Übergeneralisierung (Overgeneralization)
Wenn ein einzelnes negatives Ereignis dazu führt, dass wir den gesamten Tag oder sogar unser ganzes Leben als gescheitert betrachten, spricht man von Übergeneralisierung.
Zum Beispiel: Wir verschütten morgens die Milch. Der Tag beginnt mit Frust. Während wir das Chaos beseitigen, fürchten wir, zu spät zu kommen – wir fühlen uns gestresst und überfordert. Schon bald denken wir: „Alles läuft schief. Heute wird ein schrecklicher Tag.“

Auch bei Trennungen erleben viele Menschen diese Denkweise: „Ich bin einfach unfähig, eine Beziehung zu führen.“ Solche Gedanken sind verständlich – aber sie verstärken die deprimierte Stimmung und halten uns in einem schmerzhaften Kreislauf gefangen.
3. Egozentrisches Denken (Egocentric Thinking)
Wenn es uns schlecht geht, verengt sich unser Blickfeld. Wir kreisen um uns selbst, verlieren die Perspektive anderer aus dem Blick – das nennt man egozentrisches Denken.
Beispiel: Du hältst Pünktlichkeit für essenziell – und bist enttäuscht oder wütend, wenn andere zu spät kommen. Du beginnst, sie innerlich dafür zu verurteilen. Doch so versuchst du, Dinge zu kontrollieren, die außerhalb deines Einflussbereichs liegen. Das macht unzufrieden, verschlechtert deine Beziehungen und verstärkt das Gefühl von Isolation.
4. Emotionale Beweisführung (Emotional Reasoning)
In belastenden Momenten verwechseln wir Gefühle mit Fakten. Wir denken: Weil ich mich wie ein Versager fühle, bin ich auch einer. Das ist emotionale Beweisführung – eine besonders hinterhältige kognitive Verzerrung.
Ein Beispiel: Du kommst aus einer Prüfung und fühlst dich leer, mutlos und erschöpft. Automatisch schließt du: „Ich habe total versagt.“ Dabei könnte dein Ergebnis durchaus gut sein. Aber das Gehirn nutzt das Gefühl der Enttäuschung als vermeintlichen Beweis – obwohl es nur ein Ausdruck von Anspannung ist.
5. Selektive Wahrnehmung (The Mental Filter)
Unser Gehirn hat die Tendenz, Informationen herauszufiltern. Besonders wenn wir deprimiert sind, nehmen wir fast nur noch das wahr, was unsere negativen Überzeugungen bestätigt – ein typisches Beispiel für Selektive Wahrnehmung.

Du postest ein Foto auf Facebook, erhältst viele Likes und liebe Kommentare. Aber dein Fokus liegt auf dem einen kritischen Kommentar. Du liest ihn wieder und wieder – und beginnst an dir zu zweifeln. Unser Gehirn möchte uns „sicher“ halten, indem es die Welt vorhersehbar macht – selbst wenn das bedeutet, schmerzhafte Informationen zu bevorzugen.
6. „Ich muss“ und „Ich sollte“-Denken (Musts and Shoulds)
Gedanken wie „Ich muss das besser machen“ oder „Ich sollte anders fühlen“ setzen uns unter Druck. Diese inneren Regeln entstehen oft aus Perfektionismus – und führen dazu, dass wir jedes vermeintliche Scheitern als persönlichen Makel empfinden.
Wenn wir glauben, wir dürften niemals Fehler machen, führt jede Herausforderung zu einem emotionalen Absturz. Dieses Denkverhalten ist eine Form von kognitiver Verzerrung, die uns unbarmherzig mit uns selbst umgehen lässt.
7. Schwarz-Weiß-Denken (All-or-Nothing Thinking)
Auch dichotomes Denken genannt – es kennt keine Grautöne. „Entweder bin ich erfolgreich oder ein kompletter Versager.“ „Wenn ich nicht schön bin, bin ich hässlich.“ In dieser Denkweise gibt es kein Dazwischen – und das macht alles schwieriger.

Realität ist oft komplexer als nur schwarz oder weiß. Doch unter Stress neigt unser Gehirn dazu, sich an klare Kategorien zu klammern – sie geben vermeintlich Sicherheit. Doch gerade dadurch verlieren wir die Fähigkeit, Situationen differenziert zu betrachten. Die Folge: Fehlentscheidungen, Selbstzweifel und emotionale Tieflagen.
Wie du mit kognitiven Verzerrungen umgehen kannst
In deprimierten Phasen ist es besonders wichtig, diese Denkverzerrungen zu erkennen – nicht um sie sofort loszuwerden, sondern um einen kleinen Schritt aus ihrer Macht zu treten. Es geht nicht darum, negative Gedanken zu verbieten, sondern sie freundlich zu beobachten: „Ah, das ist wieder das Schwarz-Weiß-Denken. Ich sehe dich.“
Allein diese achtsame Haltung schwächt den Einfluss der Gedanken auf unsere Stimmung. Und sie öffnet Raum für neue Perspektiven – auch wenn sie anfangs noch leise sind.
Inspiration & Quelle:
Julie Smith: „Aufstehen oder liegen bleiben? Tools für deine mentale Gesundheit“
(Originaltitel: Why has nobody told me this before?)
Wenn wir emotional niedergeschlagen sind, erleben wir nicht nur kognitive Verzerrungen, sondern neigen auch zu übermäßigem Grübeln (Overthinking). Mehr dazu findest du in unserem Beitrag auf ichbinwert.de: 3 erprobte Methoden, um Overthinking zu stoppen.